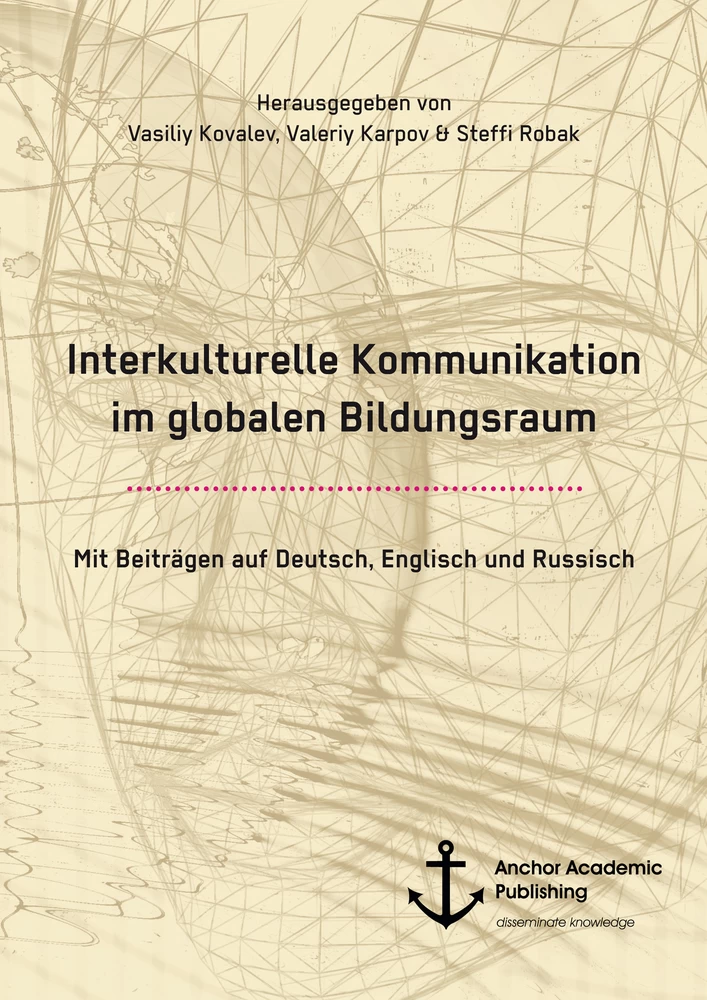Interkulturelle Kommunikation im globalen Bildungsraum
Mit Beiträgen auf Deutsch, Englisch und Russisch
©2017
Textbook
240 Pages
Summary
Der vorliegende Sammelband ist dem Thema der Interkulturalität gewidmet und enthält Beiträge in englischer, deutscher und russischer Sprache.
Vor dem Hintergrund der Globalisierung kommt dem Thema ‚Interkulturelle Kommunikation‘ eine zentrale Bedeutung zu: Durch Phänomene wie die globale Mobilität und Arbeitsteilung, zunehmende Reisefreiheit sowie die Entwicklung neuer Kommunikationstechnologien kommt es zu immer mehr Kontakten zwischen Personen unterschiedlicher Kulturen. Auswirkungen hat das auch auf den Arbeitsmarkt, der von Führungskräften zunehmend interkulturelle Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeit fordert.
Aus unterschiedlichen Perspektiven diskutieren die Autoren dieses Bandes die Bedeutung von interkultureller Kommunikation für ihre jeweiligen Disziplinen. Dem Leser wird so ein multiperspektivischer Einblick in den Diskurs um Interkulturalität ermöglicht.
This anthology adresses the topic of interculturality and, therefore, includes articles in English, German and Russian.
In the context of the ongoing globalization, intercultural communication becomes increasingly important: global mobility and division of labour, free travelling combined with new communication technologies encourages exchange between people from different cultures. This requires intercultural competence and communication skills not only in private contexts but on the labour market as well.
From different points of view the authors of this book discuss the relevance of intercultural communication. By showing how different disciplines deal with this topic the book gives the reader a multiperspective insight on the discourse of interculturality.
Vor dem Hintergrund der Globalisierung kommt dem Thema ‚Interkulturelle Kommunikation‘ eine zentrale Bedeutung zu: Durch Phänomene wie die globale Mobilität und Arbeitsteilung, zunehmende Reisefreiheit sowie die Entwicklung neuer Kommunikationstechnologien kommt es zu immer mehr Kontakten zwischen Personen unterschiedlicher Kulturen. Auswirkungen hat das auch auf den Arbeitsmarkt, der von Führungskräften zunehmend interkulturelle Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeit fordert.
Aus unterschiedlichen Perspektiven diskutieren die Autoren dieses Bandes die Bedeutung von interkultureller Kommunikation für ihre jeweiligen Disziplinen. Dem Leser wird so ein multiperspektivischer Einblick in den Diskurs um Interkulturalität ermöglicht.
This anthology adresses the topic of interculturality and, therefore, includes articles in English, German and Russian.
In the context of the ongoing globalization, intercultural communication becomes increasingly important: global mobility and division of labour, free travelling combined with new communication technologies encourages exchange between people from different cultures. This requires intercultural competence and communication skills not only in private contexts but on the labour market as well.
From different points of view the authors of this book discuss the relevance of intercultural communication. By showing how different disciplines deal with this topic the book gives the reader a multiperspective insight on the discourse of interculturality.
Excerpt
Table Of Contents
4
der Doktoranden und Doktorandinnen in die wissenschaftliche Sphäre, die
Verwirklichung der Integration von Wissenschaft und Bildung in der Praxis.
Die Forschungsarbeiten, die von den Lehrkräften unserer Hochschule
durchgeführt werden, erfassen eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Richtungen:
Wirtschaftswissenschaften,
Geschichtswissenschaft,
Rechtswissenschaften,
Sprachwissenschaften, Philosophie.
Die Hochschulangehörigen arbeiten in Kooperation mit russischen und
ausländischen Hochschulen und wissenschaftlichen Institutionen auf der Basis von
gemeinsamen Forschungsprogrammen. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden
Forschungsgruppen gebildet, wo die Wissenschaftler ihre Erfahrungen austauschen
können.
Der vorliegende Sammelband ist der interkulturellen Thematik gewidmet. Er
enthält Beiträge in englischer, deutscher und russischer Sprache. Interkulturelle
Kommunikation hat durch zunehmende Globalisierung als deren Teil eine
zunehmende Bedeutung. Außerdem kommt es durch Phänomene wie etwa der
globalen Arbeitsteilung und Mobilität, zunehmender Reisefreiheit sowie der
Entwicklung neuer Kommunikationstechnologien zu immer mehr Kontakten
zwischen Personen unterschiedlicher Kulturen. Der globale Arbeitsmarkt erfordert
von
Führungskräften
zunehmend
interkulturelle
Kompetenzen
und
Kommunikationsfähigkeit. Ein aktueller Begriff aus der Soziologie ist die
Transmigration. Die zunehmende räumliche Mobilität im Zuge der
Internationalisierung
des
Bildungssystems,
der
Globalisierung
und
Transnationalisierung führte zu einem transnationalen Karrieremuster, durch die die
Transmigranten versuchen, ihre Kompetenzen nicht nur an einem Ort, sondern
überall auf der Welt einzusetzen.
Der Band enthält Beiträge von Autoren und Autorinnen aus verschiedenen
Arbeitsbereichen. In den Arbeiten werden humanwissenschaftliche, sozial-
ökonomische und gesellschaftliche Probleme behandelt. Der Sammelband enthält
Beiträge von unseren ausländischen Kooperationspartnern und partnerinnen: Paul
Lewis Reynolds und John Day von der Universität Huddersfield (UK), Prof. Dr.
5
habil. Steffi Robak und Dr. Isabel Sievers von der Leibniz-Universität Hannover
(Deutschland). Dafür sei ihnen an dieser Stelle herzlichst gedankt.
Die meisten Autoren sind an der Omsker Filiale der Finanzuniversität tätig.
Andere Autoren sind an den anderen Hochschulen der Stadt Omsk tätig, mit denen
seit Jahren eine intensive Zusammenarbeit besteht. Wir hoffen darauf, dass sich die
Kooperation mit Wissenschaftlern aus Deutschland mit der Veröffentlichung dieses
Sammelbandes erweitern wird. Möglicherweise könnten neue Kontakte geknüpft
und internationale Forschungsgruppen gebildet werden.
An dieser Stelle sei den Kolleginnen und Kollegen vielmals gedankt, die bei
der Vorbereitung dieses Sammelbandes mit hohem Engagement gearbeitet haben.
Omsk, im Januar 2017
Prof. Dr. Valeriy Karpov,
Prof. Dr. Vasiliy Kovalev
Financial University under the Government of the
Russian Federation, Omsk Branch
6
Valeriy Karpov
Doctor of Economics, Professor,
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Omsk Branch, Russian Federation
Geografische und berufliche Mobilitätsbereitschaft von Spätaussiedlern
in Deutschland und Russlanddeutschen in Russland im Berufsverlauf:
Der Einfluss von Persönlichkeit, Migrationserfahrung, sozialem Umfeld
und Arbeitssituation
Ausgangslage
Im Rahmen der Studie sollte das Verhältnis von Migration, Mobilität und
Mobilitätsbereitschaft aus verschiedenen Perspektiven und in unterschiedlichen
Kontexten analysiert und diskutiert werden. Das Projekt ist im Rahmen der
Migrationsforschung
angesiedelt,
die
sich
als
ein
interdisziplinäres
wissenschaftliches Arbeitsfeld mit dauerhaften und grenzüberschreitenden
Verlagerungen menschlicher Wohnorte befasst. Die pädagogische Relevanz des
Projektes ist im Bereich der beruflichen Weiterbildung, der Erwachsenenbildung,
aber auch der Berufspädagogik angesiedelt.
Im Zentrum des Interesses der vergleichenden Studie stand die räumliche
Mobilität und Mobilitätsbereitschaft von Russlanddeutschen. Unter räumlicher
Mobilität verstehen Wissenschaftler jede Positionsveränderung eines Individuums
zwischen verschiedenen Einheiten eines räumlichen Systems. Räumliche Mobilität
ist unabhängig von der Reichweite der Bewegung (große oder geringe Distanzen)
und ihrer Frequenz (einmalig oder regelmäßig, selten oder häufig). Von einem
Wanderungsvorgang oder einer Migration spricht man in der Regel dann, wenn die
räumliche Mobilität eines Individuums oder einer Gruppe über eine administrative
Grenze hinweg erfolgt und auf Dauer, jedoch zumindest auf einen längeren
Zeitraum, angelegt ist.
7
Spätaussiedler unterscheiden sich von den anderen Migrantengruppen, weil sie
in den Herkunftsländern zu einer deutschstämmigen Minderheit gehörten. Die
Spätaussiedler wurden jedoch durch die Lebensbedingungen und die Alltagskultur
in den Herkunftsländern entscheidend geprägt, während ihre Zugehörigkeit zur
deutschen Minderheit in den meisten Fällen keine Handlungspraxis im Hinblick auf
Sprache und kulturelle Traditionen mehr implizierte.
Die Umsiedlung bedeutet für die Spätaussiedler einen radikalen Bruch in ihrem
Leben. Sie verlieren den Kontakt zu ihrem unmittelbaren gewohnten sozialen
Umfeld, zu den wichtigen Bezugspersonen. Sie verlieren aber auch ihren
Bildungskontext und ihren Beruf, in dem sie jahrelang gearbeitet haben. Die
Berufsbiographie von Spätaussiedlern ist durch die Aussiedlung in besonderer
Weise geprägt. Viele Abschlüsse werden in Deutschland nämlich nicht anerkannt
und viele Berufe, insbesondere aus dem landwirtschaftlichen Bereich, gibt es in
Deutschland nicht mehr.
Zielsetzung
Im Rahmen des Projektes wurde der Frage nachgegangen, welche Prädiktoren die
geografische, jobbedingte und berufliche Mobilitätsbereitschaft von Spätaussiedlern
in Deutschland und Russlanddeutschen in Russland beeinflussen. Dabei wurden
neben den Mobilitätsbereitschaftsdimensionen kontextuelle, soziodemografische,
biografische, arbeitsbezogene, soziale und personale Variablen mittels Interview
erfasst.
Vorgehensweise
Im Falle der Studie geht es um eine biographisch-vergleichende Studie zur
geografischen und beruflichen Mobilitätsbereitschaft von Spätaussiedlern in
Deutschland und Russlanddeutschen in Russland: biographieorientierte Interviews
nach dem Schneeballprinzip von Fall zu Fall (Aufenthaltsdauer, Familiensituation,
Arbeits- und Lebenszufriedenheit, berufliche Position, Erwartungen, Einstellungen,
8
Sprachkompetenz, Selbstbild und Fremdbild usw.), der Zugang zu Interviewpartnern
durch z.B. Aushänge in Institutionen (Treffpunkte, Vereine usw.).
Das Interesse galt den individuellen Schicksalen sowie den subjektiven
Erinnerungs-, Verarbeitungs- Deutungs- und Tradiermustern. Anhand der
Auswertung von biographischen Interviews mit Spätaussiedlern werden sowohl
individuelle Lebenswege und lebensgeschichtliche Erfahrungen als auch
berufsbezogene Integrationsverläufe in den 90er und 2-tausender Jahren
veranschaulicht werden.
Die Zielgruppe unterteilte sich in Spätaussiedler aus den Nachfolgestaaten der
ehemaligen UdSSR, die über 10 Jahre in Deutschland leben, und Russlanddeutsche,
die in Russland leben. Zum Zeitpunkt der Untersuchung sollen die Befragten aus
beiden Gruppen im arbeitsfähigen Alter zwischen 30 und 50 Jahren sein. Befragt
wurden Personen (Frauen und Männer), die Familie und Kinder haben.
Ferner wurde es vorgesehen, die beiden Gruppen im Hinblick auf das
Vorhandensein eines akademischen Abschlusses bei den Interviewten zu unterteilen.
Die Interviews wurden von dem Projektleiter in Englisch oder in Russisch
durchgeführt. Da er über muttersprachliche Kenntnisse der russischen Sprache
verfügt, war er optimal in der Lage, eine Vertrauensbasis zu den Probanden
herzustellen, sich auf deren sprachlichen Kompetenzen einzustellen, die Interviews
durchzuführen, wobei er kulturspezifische Besonderheiten problemlos interpretieren
konnte, und anschließend die Interviews nach qualitativen Standards auszuwerten.
In jeder Gruppe wurden 6 Personen befragt (die Hälfte davon mit einem
akademischen Abschluss). Experteninterviews wurden von Herrn Karpov in
englischer Sprache durchgeführt.
Forschungsmethoden
1. Pilotphase
In der Pilotphase des Projektes wurden u.a. ExpertInneninterviews durchgeführt.
Unser Interesse war zum einen auf die Institutionen bzw. deren pädagogische
Vertreter gerichtet, die sich mit der Integration von Aussiedlern beschäftigen.
9
Außerdem wollten wir WissenschaftlerInnen befragen, die zu diesem Thema
geforscht und publiziert haben. Experten-Interviews stellen eine spezielle Form des
Leitfaden-Interviews dar. Anders als bei biographischen Interviews interessiert der
Befragte dabei weniger als (ganze) Person denn in seiner Eigenschaft als Experte für
ein bestimmtes Handlungsfeld (vgl. exemplarisch dazu Flick 2002, S.139). Wir
haben für die Experteninterviews einen Fragenkatalog entwickelt, der in sechs
Abschnitte unterteilt war:
Angaben zur Person
I.
Allgemeine Fragen
II.
Prozess der Veränderungen
III.
Kompetenzen
IV.
Berufliche Situation
V.
Mobilität und Mobilitätsbereitschaft
VI.
Anmerkungen
Für die Interviews mit den PraktikerInnen und den WissenschaftlerInnen wurde
der gleiche Fragenkatalog bzw. Leitfaden verwendet. Dabei wollten wir eventuelle
Tendenzen, gemeinsame Deutungen sowie Unterschiede in den verschiedenen
Aussagen festhalten. Mit diesen Interviews wollten wir die geografische und
berufliche Mobilitätsbereitschaft von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern
möglichst ausführlich, d.h. aus verschiedenen Sichtweisen erforschen.
Alle
interviewten
ExpertInnen
meinen,
dass
Migration
einen
lebensgeschichtlichen Bruch für alle Familienmitglieder einer jeweiligen Familie
darstellt, der mit krisenhaften Erscheinungen verbunden ist. Es überwiegt also eine
Krisen- und Problemperspektive. Migration löst in vielen Fällen Familien- und
Generationenkonflikte aus.
Das Thema des Projektes ist so gut wie nicht empirisch untersucht worden.
Durch einen Aufnahmebescheid anerkannten Aussiedler gehen nach einem Jahr in
die Bevölkerungsbestandsstatistik ein, eine Ausnahme bilden dabei die Statistiken
der Bundesanstalt für Arbeit, wo sie fünf Jahre lang als Aussiedler geführt werden.
Nach fünf Jahren sind die Aussiedler also nicht mehr als eine zugewanderte Gruppe
10
identifizierbar, was die Erforschung der langfristigen Folgen deren Migration
wesentlich erschwert.
2. Hauptuntersuchung
2.1.1. Festlegung des methodischen Vorgehens
Der methodische Ansatz der vorliegenden Untersuchung sollte im Hinblick auf die
Auswertung folgende Betrachtungsweisen ermöglichen. Zum einen sollen durch die
personenbezogene Analyse von Einzelinterviews individuelle Auswirkungen der
Migration auf die berufliche Situation, Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung
der Aussiedlerinnen aufgezeigt werden. Zum anderen sollte eine gezielte
Auswertung zu Einzelaspekten der gewählten Fragestellung unter dem Blickpunkt
der themenbezogenen Analyse vorgenommen werden. Um diese Herangehensweise
an das Material zu ermöglichen, war eine methodische Konzeption der Interviews
notwendig, die sowohl eine Fokussierung auf bestimmte Fragestellungen als auch
Spielräume für erzählende Passagen durch die Interviewpartnerinnen zuließ. Eine
solche Möglichkeit bietet das problemzentrierte Interview, wie es als Verfahren
qualitativer Analyse von Mayring (1993, S. 46ff.) dargestellt wird. Diese
Vorgehensweise, die auf das ,,fokussierte Interview" von Merton und Kendall (1945,
hier 1979) zurückgeht, bedient sich eines Interviewleitfadens. Mit der Hilfe dieses
Leitfadens werden die Interviewten auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt und
reagieren darauf offen, ohne jegliche Antwortvorgaben.
Die Standardisierung im problemzentrierten Interview ermöglicht die
Vergleichbarkeit mehrerer Interviews, weil das vorliegende Material auf die
jeweiligen Fragen des Leitfadens bezogen werden und so leichter ausgewertet
werden kann (vgl. ebd. S. 49). Obwohl für diese Art des Interviews eine
Standardisierung typisch ist, kann sich das problemzentrierte Interview dem
narrativen Interview annähern. Dies geschieht dadurch, dass im problemzentrierten
Interview auch erzählende Passagen oder von der Fragestellung abweichende
Aspekte zugelassen werden.
11
2.1.2. Festlegung der Interviewdurchführung
Die obenangeführte Darstellung des methodischen Ansatzes lässt es deutlich
werden, dass bei der Durchführung eines problemzentrierten Interviews ein
Balanceakt zwischen dem durch den Leitfaden vorgegebenen Erkenntnisinteresse
des Wissenschaftlers und den individuellen Schwerpunktsetzungen der befragten
Personen angestrebt werden soll.
Für die Hauptuntersuchung nutzten wir einen am Ende der Pilotphase
entwickelten Fragenkatalog und einen Kurzfragebogen (vgl. Anhang). Der
Fragenkatalog wurde in sechs Abschnitte unterteilt:
Angaben zur Person
I.
Allgemeine Fragen
II.
Prozess der Veränderungen
III.
Kompetenzen
IV.
Berufliche Situation
V.
Mobilität und Mobilitätsbereitschaft
VI.
Anmerkungen
2.2.2. Bildung der Auswertungskategorien und Zuordnung des Materials
Der methodische Ansatz der vorliegenden Studie lässt sich in Anlehnung an die
Ausführungen von Mayring (1983, vgl. 2000) als ein Verfahren der qualitativen
Textanalyse beschreiben, d.h. sie bezieht sich auf die qualitative Inhaltsanalyse, eine
der klassischen Vorgehensweisen zur Analyse von Textmaterial gleich welcher
Herkunft. Ein wesentliches Kennzeichen ist die Verwendung von Kategorien, die
häufig aus theoretischen Modellen abgeleitet sind: Kategorien werden an das
Material herangetragen und nicht unbedingt daraus entwickelt, wenngleich sie
immer wieder daran überprüft und gegebenenfalls modifiziert werden. Im Gegensatz
zu anderen Ansätzen ist das Ziel hier vor allem die Reduktion des Materials (vgl.
Flick 2000, S.279). Die qualitative Textanalyse beginnt nach Mayring mit der
Festlegung des Materials, der Auswahl der Interviews bzw. der daraus für die
Fragestellung
interessanten
Teile.
Weiter
werden
die
Analyse
der
12
Erhebungssituation und formale Charakteristik des Materials vorgenommen. Ferner
wird das Material analysiert um festzustellen, welche Aussagen bzgl. der verfolgten
Fragestellung daraus gewonnen werden können.
Schlussfolgerungen in Hinblick auf die Fragestellung der vorliegenden Studie
Migration und Mobilität werden vielfach als unterschiedliche Phänomene
wahrgenommen und diskutiert. Von Migration wird eher dann gesprochen, wenn es
um Arbeitskräftewanderungen aus nicht europäischen Ländern, aus Drittstaaten oder
um Flucht und Asyl geht. Als Mobilität werden zum einen innereuropäische und
speziell inner-EU-Wanderungen und generell auch Wanderungen von
Hochqualifizierten bezeichnet. Im Rahmen der Studie untersuchten wir folgende
Zielgruppe: Spätaussiedler aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR, die
über 10 Jahre in Deutschland leben, und Russlanddeutsche, die in Russland leben.
Bei der Arbeit am Projekt konnten wir feststellen, dass man allgemein über eine
Pluralisierung von Migration und Mobilität reden kann. Diese Pluralisierung hat
sich in den vergangenen Jahren nicht zuletzt aufgrund verbesserter
Verkehrsbedingungen, Reisemöglichkeiten und neuer Informationstechnologien
verstärkt. Die Spätaussiedler/innen (und auch andere Migrantengruppen) bewegen
sich täglich in verschiedenen räumlichen und zeitlichen Dimensionen. In diesen
Kategorisierungen werden unterschiedliche Profile geografischer Mobilität sichtbar,
die vielfach auch durch eine multilokale Existenzweise geprägt sind. Darüber hinaus
sind diese Kategorien sowohl Resultat individueller Handlungen als auch von
staatlichen Bemühungen einer Regulierung von Migration und Mobilität. Während
die lange etablierten, weiterhin existierenden Formen der Migration vielfach durch
Aufbrechen und Weggehen einerseits und Ankommen bzw. Bleiben andererseits
gekennzeichnet sind, sind für die neueren Formen geografischer Mobilität eher
kontinuierliche Bewegungen von Menschen und Dingen charakteristisch. Dies
spiegelt sich z.B. in dem Versuch, durch das Präfix ,,trans" (Transmigration etc.) den
neuen (Erscheinungs-)Formen geografischer, aber auch sozialer Mobilität Rechnung
zu tragen. Wichtig für die Mobilität der Spätaussiedler in Deutschland ist oft ihre
13
doppelte Staatsbürgerschaft, die es ihnen ermöglicht, ohne Probleme gegebenenfalls
auch zwischen den Staaten zu pendeln. Interessanterweise kann bei den
Mobilitätsformen von Russlanddeutschen in Russland auch von Transmigration die
Rede sein, weil viele von ihnen nach dem Zusammenbruch von der UdSSR
zentralasiatische Staaten verlassen haben und nach Russland umgesiedelt sind, aber
immer noch dort Verwandten haben und ihre Herkunftsländer besuchen. Die beiden
Gruppen zeigten eine hohe räumliche Mobilitätsbereitschaft auf, was auf ihre
Migrationserfahrungen möglicherweise zurückzuführen ist.
Ausblick
Ob es sich wirklich um neue Formen von Mobilität resp. Migration handelt, ist zu
prüfen. Auch der Frage nach dem Zusammenhang zwischen den verschiedenen
Formen geografischer, sozialer und alltäglicher Mobilität auf der einen Seite und
sozialen Milieus, Lebensstilen und Identitätskonstruktionen, die als ,,hybrid",
,,multilokal" und ,,glokal" bezeichnet werden, auf der anderen Seite ist nachzugehen.
Von daher kann die Untersuchung der Transmigrationsformen russlanddeutscher
Aussiedler (Push- und Pull-Motive, Gründe, Deutschlandbild,
Migrationserfahrungen etc.) als eines der möglichen Themen für spätere
Forschungsprojekte empfohlen werden.
14
Literaturverzeichnis
-
Bade, Klaus: Ausländer Aussiedler Asyl. Eine Bestandsaufnahme.
München 1994
-
Bastians, Frauke: Die Bedeutung sozialer Netzwerke für die Integration
russlanddeutscher Spätaussiedler in der Bundesrepublik Deutschland.
Bissendorf: Methoos, 2004
-
Branik, Emil: Psychische Störungen und soziale Probleme von Kindern und
Jugendlichen aus Spätaussiedlerfamilien. Ein Beitrag zur Psychiatrie der
Migration. Weinheim und Basel: Beltz, 1982
-
Dembon, Gerold: Fremde Deutsche in deutscher Fremde:
Integrationsprobleme von Aussiedlern im kommunalen Raum / Gerold
Dembon; Dieter Hoffmeister; Heinz Ingenhorst. - Regensburg: Roderer, 1994
-
Deutsches Jugendinstitut e.V. (Hrsg.): Die mitgenommene Generation.
Aussiedlerjugendliche eine pädagogische Herausforderung für die
Kriminalitätsprävention. München 2002
-
Flick, Uwe: Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung: Reinbek 2002
-
Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Deutsch sein und
doch fremd sein. Lebenssituation und -perspektiven jugendlicher Aussiedler.
Gesprächskreis Arbeit und Soziales, Nr.84. Bonn 1998
-
Fuchs, Marek: Die Wohnungssituation der Aussiedler, in: Silbereisen, Rainer
K. / Lantermann, Ernst-Dieter. / Schmitt-Rodermund, Eva. (Hrsg.): Aussiedler
in Deutschland: Akkulturation von Persönlichkeit und Verhalten. Opladen
1999, S. 91 - 102.
-
Gawlik, Edith: Berufliche Förderung von Aussiedlerfrauen zu ihrer sozialen
Integration. Fakten, Probleme, Erfolgschancen. Bielefeld: Bertelsmann 1996
-
Herwartz-Emden, Leonie: Mutterschaft und weibliches Selbstkonzept: eine
interkulturell vergleichende Untersuchung. Weinheim: Juventa-Verlag 1995
-
Herwartz-Emden, Leonie (Hrsg.): Einwandererfamilien. IMIS-Schriften.
Bd. 9. 2.unveränd. Aufl. Göttingen 2003
15
-
Ingenhorst, Heinz: Die Russlanddeutschen. Aussiedler zwischen Tradition
und Moderne. Frankfurt a. M. 1997
-
Janikowski, Andreas: Berufliche Integration der Aussiedler und
Aussiedlerinnen, in: Silbereisen, Rainer K. / Lantermann, Ernst-Dieter. /
Schmitt-Rodermund, Eva. (Hrsg.): Aussiedler in Deutschland: Akkulturation
von Persönlichkeit und Verhalten. Opladen 1999, S. 113 - 142.
-
Lantermann, Ernst-Dieter / Hänze, Martin: Werthaltung, materieller
Erfolg und soziale Integration von Aussiedlern, in: Silbereisen, Rainer K. /
Lantermann, Ernst-Dieter. / Schmitt-Rodermund, Eva. (Hrsg.): Aussiedler in
Deutschland: Akkulturation von Persönlichkeit und Verhalten. Opladen 1999,
S. 165 - 183.
-
Lingnau, Susanne: Erziehungseinstellungen von Aussiedlerinnen aus
Russland. Ergebnisse einer regionalen empirischen Studie. Bibliotheks- und
Informationssystem der Universität Oldenburg, 2000
-
Mayring, Philipp: Einführung in die qualitative Sozialforschung. 2. Aufl.,
Weinheim 1993
-
Schmitt-Rodermund, Eva / Silbereisen, Rainer K.: Gute Miene zum bösen
Spiel: Resilienz unter arbeitslosen Aussiedlern, in: Silbereisen, Rainer K. /
Lantermann, Ernst-Dieter. / Schmitt-Rodermund, Eva. (Hrsg.): Aussiedler in
Deutschland: Akkulturation von Persönlichkeit und Verhalten. Opladen 1999,
S. 277 - 299.
-
Strobl, Rainer/ Kühnel, Wolfgang: Dazugehörig und ausgegrenzt. Analysen
zu Integrationschancen junger Aussiedler. Weinheim und München 2000
16
Steffi Robak
Professor, Grand PhD.,
Managing Director of the research team DiversitAS
The University of Hanover, Germany
Lern- und Bildungsprozesse von Expatriates in transnationalen Unternehmen
in China: Zur Rolle von "Kulturprogrammen", kulturellen Differenzen und
Wissensressourcen
Der Beitrag diskutiert ausgewählte theoretische Grundlagen und empirische
Ergebnisse meiner Habilitationsstudie (Robak 2012), die sich mit Lern- und
Bildungsprozessen deutschsprachiger Expatriats in globalen Unternehmen in China
beschäftigt. Es wird eingangs gezeigt, dass es keine ausreichend entwickelten
Konzepte einer integrierten Lernkulturgestaltung für transnationale Unternehmen
gibt. Anschließend werden theoretische Prämissen zur Erschließung von Wissen,
Lernformen, Kultur und kulturellen Differenzen entwickelt, die in ein empirisches
Analysemodell eingehen. Exemplarische empirische Ergebnisse am Beispiel zweier
analysierter Typen, die klassischen Expatriats und die Kosmopolitischen Nomaden,
belegen kulturelle Hybridbildungsprozesse, die Einfluss auf Arbeits- und
Lernprozesse nehmen und Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten durch
transnationale Lernkulturen benötigen.
1. Zur mangelnden Verknüpfung von Wissensressourcen in Lernkulturen
Berufliche Wissensstrukturen, Kompetenz und (inter)kulturelles Wissen sind zu
wichtigen Faktoren der Globalisierung erwachsen. Konzepte und Praxis, die sich in
entsprechend integrierten Lernkulturen widerspiegeln müssten, so zeigen die
vorliegenden Auswertungen (vgl. Robak 2011a, 2012), bereiten jedoch nicht
ausreichend darauf vor. Nicht nur berufliches Wissen erweist sich als ungesichert,
sondern auch kulturelles Wissen wird nicht ausreichend vermittelt, um in
Lernkulturen, Strukturentscheidungen und Arbeitsprozessen wirksam zu werden.
17
Bildungswissenschaftliche Perspektiven sind bislang für die verschiedenen
betroffenen Berufs- und Bevölkerungsgruppen nicht aufgearbeitet, obwohl
wirtschaftliche Verflechtung ein vielkonstatiertes Phänomen ist (vgl. Faulstich
2009). Am Beispiel der Globalisierung nach China wird dies besonders sichtbar, die
Unternehmen möchten ,,am Markt Schritt halten" und am Wachstum partizipieren.
Nicht nur die Produktion wird verlagert, sondern auch Forschung und Entwicklung
(Chamber of Commerce in China 2011). Besonders der Wissenstransfer ist in
rechtlichen Regelungen festgelegt, chinesische Unternehmen möchten von den
Wissensressourcen der Expatriates profitieren. Damit zusammenhängende
Problemlagen im Bereich der Zusammenarbeit belegt besonders die sogenannte
,,Joint-Venture-Forschung" (z.B. Schuchardt 1994).
1
Neue Optionen der
strategischen Steuerung eröffnet die Form der ,,Wholly Foreign Owned Enterprises",
die an Stellenwert gewinnt. Veränderte ökonomische Gestaltungsoptionen evozieren
neue Anforderungen im Bereich der Kompetenzentwicklung.
Trotz dieser Entwicklungen verweisen die Konzepte des internationalen
Personalmanagements
(IPM)
(Jammal
2001),
der
internationalen
Personalentwicklung und des Expatriate Managements um eine Auswahl an
wichtigen Zugängen zu nennen bislang auf eine Unterbewertung von
Weiterbildung, der Wissensanforderungen und eine Unterbewertung kulturellen
Wissens.
Dies wird an parzellierten Konzeptualisierungen des Zusammenhangs von
Kultur, Wissen, Qualifizierung und Bildung sichtbar. Zum einen erfolgt eine
Subsummierung unter ökonomischen Perspektiven: Der Aufgabenmodus des
Personalmanagements steht im Fokus und platziert Qualifizierung unspezifisch, z.B.
neben der Personalauswahl, Anreizgestaltung und dem Mitbestimmungs-
management (Süß 2004, S. 33). Wissensfelder des IPM sind dann:
1
Ein Joint Venture ist eine von chinesischer Seite gesetzlich veranlasste Unternehmensform, die eine
ökonomische Bindung des Kapitals regelt und einen Wissenstransfer sichert. Besonders eng müssen
Managementhandeln und Entscheidungen zwischen Managern und Beschäftigten verschiedener kultureller
Zugehörigkeiten dort abgestimmt werden.
18
Wissensvermittlung
Schaffung kulturspezifischer
Fähigkeiten/ interkultureller
Kompetenz
Länder- und
kulturbezogenes
Wissen
Unternehmens-
spezifisches
Wissen
Schaffung kultur-
allgemeiner
Fähigkeiten
Schaffung
kulturspezifischer
Fähigkeiten/
interkultureller
Kompetenz
Tab.: Wissensfelder des Internationalen Personalmanagements (Süß 2004,
S. 107)
Aufnahme findet interkulturelles Wissen in einer spezifischen Weise; als
,,zusätzliche" Anforderung. Von zentralem Interesse ist die Einbindung in eine
Unternehmensperspektive. Mit der Hervorhebung des unternehmensspezifischen
Wissens ist informelles Lernen im Sinne von Informationsbeschaffung im
Unternehmen eingeleitet. Eine umfassende Absicherung und Förderung von
Qualifikation und Kompetenzentwicklung mit Anteilen an Wissensvermittlung ist
nicht vorgesehen.
2
Von zunehmendem Interesse ist das ,,Internationalisierungs-
wissen", Wissen über Märkte ist damit besonders angesprochen. Es finden sich
jedoch keine Hinweise auf komplexe Angebotsstrukturen (vgl. auch
Gieseke/Robak/Wu 2009), die diese Wissensressourcen vor Ort einspeisen, vielmehr
fordert die Literatur im Radius des IPM ,,kooperative Selbstqualifikation", d.h. der
Arbeitsplatz selbst ist der Ort der optimalen Qualifizierung und Internationalisierung
(Fröhlich 2000, S. 21).
Parzellierung des Wissens ist auf der anderen Seite auch im Bereich der
interkulturellen Trainingspraxis zu konstatieren: Eine Analyse der Ansätze
interkultureller Kompetenz zeigt eine verengte Überbetonung essenzialistischen
Kulturwissens. Vertreter des Bereiches interkulturelle Kommunikation kritisieren
ein ,,Steckenbleiben" der Trainingspraxis (vgl. Moosmüller 2007). Der
Kompetenzbegriff hat zu wenig theoretische und konzeptionelle Innovationen
2
Als kulturspezifisches Wissen haben die Kulturdimensionen von Hofstede (1980) Eingang in Konzepte
des IPM gefunden (zur kritischen Analyse siehe Robak 2012).
19
ermöglicht. Von aufklärerischen Bildungsanteilen kann in verkürzten Machbarkeits-
und Anpassungsansätzen keine Rede sein (vgl. Messerschmidt 2009).
Die Ursachen der parzellierten Wissensbearbeitung sind, so zeigen auch
Interviews mit Personalentwicklern, die im Rahmen meiner Habilitationsstudie
geführt wurden (Robak 2012), mehrfaktoriell: Es liegt zu wenig Wissen über die
realen Arbeitsplatzanforderungen unter kulturdifferenten Bedingungen vor.
Entsendungen selbst werden von Unternehmen als Personalentwicklung betrachtet
(siehe auch Berthel/Becker 2013). Die organisationalen Formen transnationaler
Personalentwicklung bzw. transkultureller Lernkulturgestaltungen sind noch
unterentwickelt. Die Literaturlage lässt weiterhin die Vermutung zu, dass der
Mythos einer zielführenden kulturspezifischen Auswahl von Expatriates immer neu
genährt wird (vgl. Deller 2000). Mit einer kulturspezifizierenden Auswahl ist die
Hoffnung verbunden, kulturelle Reibungsflächen zu umgehen und kulturelle
Differenzen im Arbeitsprozess durch spezifische Persönlichkeitsstrukturen
auszugleichen. Eine wichtige Fragestellung lautet deshalb: Auf welche
Wissenszuschnitte und welche Bearbeitungsformen/ Lernformen greifen
deutschsprachige Expatriates in global operierenden Unternehmen in der VR China
zurück? Sind Wissensressourcen in Form von Lernkulturen für diese Gruppen
ausreichend abgesichert, die sowohl eine Professionalisierung ermöglichen als auch
die Erfüllung der unmittelbaren Arbeitsplatzanforderungen und darüber hinaus
kulturelle Partizipation unterstützen? Zunächst soll ein Ausschnitt des abduktiv
(Reichertz 2003) entwickelten Analysemodells erläutert werden. Es folgen
exemplarische empirische Ergebnisse am Beispiel zweier analysierter Typen.
2. Konzeptualisierung zur Erfassung des Zusammenhangs von Wissen und
Lernformen sowie Kultur und kultureller Differenz
2.1. Praktiken und Hybridisierungsprozesse als theoretische Bezüge der
empirischen Analyse
Die Auswertung von Kulturtheorien im Radius kultureller Differenz zeigte, dass
Diskurse, die sich mit Identität, Wertestrukturen, kulturellen Angleichungsprozessen
20
und postkolonialen Folgen auseinandersetzen, besonders wichtig sind für kritische
Analyseperspektiven und Interpretationen, jedoch einer grundsätzlichen
theoretischen Ergänzung bedürfen, um den Blick auf die konkreten Phänomene der
Entstehung transnationaler Räume und kultureller Bedeutungswelten (Schriewer
2007)
zu
richten.
Länderübergreifende
gesellschaftsformende
Modernisierungsprozesse
haben
-
besonders
über
transnationale
Unternehmensstrukturen (Köhler 2004) - Räume des Kulturtransports entstehen
lassen, die durch Arbeitsstrukturen Fakten schaffen. Als kleinste Analyseeinheit
können ,,Praktiken" eingeführt werden. Sie bilden die Grundlage des vorliegenden
Analysemodells.
Kulturtheoretische Annahmen haben neue Impulse zur Beschreibung und
Verortung von Praktiken im Rahmen eines cultural turn der Sozialwissenschaften
gegeben. Dem Kulturbegriff werden über Praktiken Wertungen entzogen. Der
Praktikenbegriff wird synthetisierend praxistheoretisch entwickelt (Reckwitz 2003):
Praktiken bilden demnach den Kern von Kultur. Einen besonderen Stellenwert erhält
dabei das praktische Wissen, d.h. ,,ein Können, ein know how, ein Konglomerat von
Alltagstechniken, ein praktisches Verstehen im Sinne eines ,Sich auf etwas
verstehen`" (ebd., S. 289). Reckwitz geht es um die Beschreibung übergreifender
individuumsunabhängiger Entwicklungen, die über Praktiken Modernisierungs-
prozesse voranbringen.
Für
kulturdifferente
Arbeitskontexte
mit
differenten
objektiven
Ausgangsbedingungen stellt sich nun die Frage: Wie werden Praktiken routinisiert?
Gehen berufliche und kulturelle Wissensressourcen im Arbeitszusammenhang in die
Konstitution von Praktiken ein und wie ist dieser Prozess durch Weiterbildung und
Lernkulturen zu unterstützen?
Der Zugang über Praktiken (Reckwitz 2003, 2006) erlaubt einen empirischen
Zugriff. Reckwitz geht davon aus, dass kollektive Wissensstrukturen in Praktiken
aufgehoben sind, darüber transportiert werden und aufgrund dessen eine gewisse
Materialität ausbilden, die sich dann auch in Strukturen, Institutionen und Artefakten
ausdrückt. Diese Annahmen wendet er durch die Explikation spezifischer Praktiken
21
in eine ,,praktikengeleitete" Analyse der Beschaffenheit und Entwicklung der
Moderne (Reckwitz 2006). Praktiken der Arbeit, so die Prämisse der vorliegenden
Studie (Robak 2012), spielen im kulturdifferenten Arbeitskontext in Unternehmen
eine zentrale Rolle. Über Praktiken werden Hybridbildungen erzeugt, die so ist zu
vermuten in unterschiedlichen Ländern je spezifisch strukturiert sind.
Hybridisierung meint bei Reckwitz, dass die verschiedenen Phasen der Moderne
unterschiedliche Kodierungen und Erscheinungsformen an Praktiken hervorbringen
und diese jeweils in der zeitlich darauffolgenden Phase neu verkodet werden und
sich dadurch verändern. Für die vorliegende Untersuchung wird dieser
Hybridisierungsbegriff
erweitert
um
Elemente
eines
,,kapitalistischen
Kulturprogramms" und um spezifische kulturelle Differenzen und es wird danach
gefragt, ob und wie diese in Unternehmen in China Eingang in Praktiken finden
(siehe Kap. 2.3).
Während für Reckwitz der Ursprung von Wissen und Können nicht
entscheidend ist und er die Überindividualität der Praktiken besonders hervorhebt,
wird mit dem gewählten analytischen Zugriff davon ausgegangen, dass die
Individuen einen hohen gestaltenden Anteil an der Ausformung von Praktiken haben
und deren Konstruktionsprozess unter bildungswissenschaftlicher Perspektive mehr
Aufmerksamkeit zu schenken ist. Eine gewendete Annahme ist: Praktiken können
durch Individuen verändert und hervorgebracht werden, sie können durch
Einzelinteressen auch beeinflusst werden. Zu klären ist die Funktion, die
Lernkulturen und Weiterbildung dafür übernehmen.
2.2. Entwicklung eines mehrdimensionalen Analysemodells im Modus
abduktiver Forschungslogik
Die übergeordnete Ausgangsfragestellung der Studie zielt zum einen auf die
Analyse von Hybridbildungen im Arbeitsprozess und die diesen Prozess
begleitenden Lern- und Bildungsprozesse ab. Zum anderen wurden alle Lern- und
Bildungsmöglichkeiten jenseits des Arbeitskontextes erfragt.
22
Insgesamt wurden 43 Leitfadeninterviews mit Expatriates in China, davon 4
Folgeinterviews nach 1,5 Jahren geführt sowie 8 Leitfadeninterviews mit
Personalentwicklern im Bereich Internationale Personalentwicklung und
Trainer/inne/n im Bereich Interkulturalität. Es waren insgesamt drei
Interviewformate notwendig, die an der Generierung eines abduktiven
Forschungsmodells beteiligt sind:
1. Interviews mit Expatriates;
2. Interviews mit Experten der Personalentwicklung, des interkulturellen
Trainings und des Entsendungsmanagements. Für jede dieser Gruppen
wurden die Interviewleitfäden angepasst;
3. Interviews mit Expatriates, die gleichzeitig Experten im Bereich Sinologie
sind und Auskunft über die Problemlagen in Entsendungsprozessen nach
China und über den kulturellen Wandel geben können.
Die Erstellung, Weiterentwicklung und Durchführung der Interviewformate
war Teil eines abduktiven Forschungsprozesses (Reichertz 2003), d.h. es gab einen
permanenten
rekursiven
Rückbezug
zwischen
der
Entwicklung
des
Erhebungsinstruments, der Ausarbeitung der theoretischen Grundlagen und der
Entwicklung eines Auswertungsmodells, das sich sukzessive aus den theoretischen
Grundlagen konstruiert, indem es parallel empirisch entfaltet wird. In einem
Forschungsprozess, der dieser Logik folgt, stehen der Prozess der Abduktion und die
Bildung einer Hypothese in einem engen Zusammenhang. Der Begriff der
Abduktion will der Entstehung kreativer Ideen einen theoretischen Boden geben und
den dahinter stehenden Prozess nachvollziehbarer machen. Die Abduktion steht am
Beginn einer Erkenntnis. Sie führt zu einer Hypothese, die es dann zu prüfen gilt.
Die Hypothese steht also nicht am Anfang, sondern ist der Endpunkt, das Ergebnis
eines Abduktionsprozesses.
Das entwickelte Modell besteht aus drei Prozessebenen:
· Prozessebene I: Psychodynamische Akkulturation/Anpassung individuelle
biographische Bedingungen und Lernvoraussetzungen (wird in diesem Artikel
nicht erläutert),
23
· Prozessebene II: Professionalisierung und Qualifizierung individuelle
Lernformen (siehe Kap. 2.5),
· Prozessebene III: Bildung und Kulturalität individuelle Zugänge zum
kulturellen Lernen und zu kultureller Bildung (siehe Kap. 2.4).
Den zweiten Teil des Modells bilden folgende entwickelte drei Lerndimensionen:
· Arbeitspraktiken (siehe Kap. 2.1 und 2.3)
· Kulturstandards (siehe Kap. 2.3)
· Deutungsmuster (wird in diesem Artikel nicht erläutert).
Die Begründung für Arbeitspraktiken als Lerndimension ergibt sich aus der
theoretischen Konzeptualisierung und der Festlegung von Arbeitspraktiken als die
entscheidende Analysekategorie im Prozess der Zusammenarbeit (siehe Kap. 2.1).
Es interessieren dabei besonders die Prozesse, die zu einer Verdichtung von
Praktiken führen und sich in Routinen sedimentieren. Kulturstandards wirken in jede
Form der interaktiven Zusammenarbeit hinein, insofern fließen sie ,,quer" durch alle
Prozessebenen hindurch und nehmen Einfluss auf die Konstitution von Praktiken als
sie auch als Gegenstand von Lern- und Bildungsprozessen zu erwarten sind (siehe
Kap. 2.3). Deutungsmuster haben sich als eine entscheidende Lerndimension
herausgestellt. Der Zusammenhang zwischen Erlebnissen, Erfahrungen, Deutungen
und Deutungsmustern ist leitend und essentiell, um in der Analyse zu
rekonstruieren, ob Fähigkeiten des Deutens in fremdkulturellen Kontexten aufgebaut
werden, ob neue Deutungen konstituiert bzw. Deutungserweiterungen oder gar
Fähigkeiten fremdkultureller Deutungsmusterrezeption aufgebaut werden (vgl.
Dybowski/Thomssen 1976; Arnold 1985; Schüßler 2000).
Jedes einzelne Interview wurde entsprechend dieses Modells analysiert, es
konnten vier Typen (nach Kluge 1999) gebildet werden:
· ,,Expat Classico" (siehe Kapitel 3.1)
· Postmoderne Kosmopoliten (wird in diesem Artikel nicht erläutert)
24
· Employability Nomaden (wird in diesem Artikel nicht erläutert)
· Kosmopolitische Nomaden (siehe Kapitel 3.2).
Im Folgenden werden weitere zentrale Zusammenhänge des geschilderten
Analysemodells erläutert, um im Anschluss zwei Typen näher darzustellen.
2.3. Zu den Wirkungsweisen ,,doppelter" Kulturkonzepte
Betrachten wir Praktiken als kleinste Einheit von Kultur, so ist für kulturdifferente
Arbeitszusammenhänge - wie hier für deutsche Unternehmen in China - von der
parallelen Wirksamkeit zweier Kulturkonzepte auszugehen, die jeweils
unterschiedliche Wissensanforderungen produzieren.
Fokussieren wir Arbeitspraktiken, dann betrifft dies die Umsetzung
postbürokratischer Arbeitspraktiken im Übergang vom Angestelltensubjekt zum
Kreativ-konsumtorischen Subjekt (vgl. Reckwitz 2006). Da die Anforderung der
,,Selbstvermarktung" in viel beschriebener Weise zunimmt (siehe besonders
Bröckling 2007), der Einzelne als Teil kapitalistischer Strukturen die Anforderungen
der Selbstkreation und der unternehmerischen Marktförmigkeit annehmen soll,
betrachten wir das Subjekt als ,,unternehmerisches Kreativsubjekt", das sich in
postbürokratische Arbeitspraktiken wie Projektarbeit, mobiles, flexibles und
digitalisiertes Arbeiten mit einer hohen Selbstkontrolle und mit hoher
kommunikativer Kompetenz einsozialisiert und die unternehmerischen Prinzipien
für alle Lebensbereiche - mehr oder weniger widerständig - zu übernehmen sucht
(vgl.
Reckwitz
2006).
Mechanismen
und
Folgewirkungen
dieser
gesellschaftsverändernden kapitalistischen ,,Steuerungsintentionen", die als
Metakulturprogramm bezeichnet werden können, werden bereits kritisch diskutiert
(vgl. Boltanski/Chiapello 2003). Folgen für individuelle Bildungsbiographien und
Bildungspartizipation sind noch nicht ausreichend untersucht worden.
25
Abb. 1: "Metakulturelles Kapitalistisches Kulturprogramm" (Eigene Darstellung)
Hybridisierung als die Einübung in postbürokratische Arbeitspraktiken kann man
sich als eine Signatur unserer Zeit vorstellen. Parallel zu diesen metakulturellen
Anforderungen müssen die Expatriates mit kulturellen Differenzen umgehen. Diese
lassen sich bezogen auf China mit Kulturstandards (Thomas 1996) umschreiben.
Kulturstandards sind für Thomas (ebd.) der sozialisierte Kern des kulturellen
Orientierungssystems. Sie regulieren und leiten die alltägliche Kommunikation und
das Handeln. Werte bilden den Kern. Kulturstandards systematisieren
essenzialistisch kulturelle Differenz, sie erweisen sich jedoch so zeigen die
Interviews - in der Realität als wirksam. Für den chinesischen Kulturraum wurden
spezifische Kulturstandards entwickelt, sie befinden sich aufgrund stattfindender
Modernisierungsprozesse im Wandel. Als Grundlagenwissen finden sie in der
interkulturellen Trainingspraxis Verwendung. Relevante, durch Vorinterviews
generierte Kulturstandards sind: Hierarchieorientierung, Gesicht wahren und geben,
ein Beziehungsnetz herstellen und pflegen. Zusätzlich hinzugezogen wurde die
indirekte Kommunikationsweise. Als obsolet in den untersuchten Unternehmen
erweist sich z.B. der Kulturstandard ,,Harmonie herstellen".
Über den kulturellen Standard ,,Gesicht wahren und geben" ist bereits sehr viel
an Wissen vorhanden. Obwohl ,,Gesicht" eine universelle Komponente in allen
Interaktionen kulturübergreifend zuzuschreiben ist (Goffman 1966), scheinen damit
in China besondere soziale Kodierungen von hoher kommunikativer und kultureller
26
Reichweite verbunden zu sein. Sie beschreiben ein Spektrum an kommunikativen,
zum Teil strategisch gestuften Handlungsstrategien (Weidemann 2004). Der
Kulturstandard ,,Gesicht wahren" wurzelt in Vorstellungen von höflicher
Zurückhaltung (Liang 1992; Lee-Wong 2000). ,,Gesicht geben" konstituiert darüber
hinaus die durch die konfuzianische Lehre vorgegebenen Respektsbezeugungen
entlang hierarchischer Beziehungsstrukturen (Liang 1992, S. 22f.). Von
herausragender Bedeutung ist der Kulturstandard ,,Beziehungen herstellen". Sein
Stellenwert scheint sukzessive zuzunehmen; alle setzen sich damit auseinander und
beginnen u.U. damit, sich darin ,,einzuüben".
Diese Kulturstandards formen im entwickelten Modell eine eigene
Lerndimension und sind als Erhebungs- und Analysedimension aufgenommen (vgl.
auch Robak 2013).
Die Expatriates müssen mit diesen beiden kulturellen ,,Programmen", dem
,,kapitalistischen
Kulturprogramm"
und
den
Kulturstandards,
im
Arbeitszusammenhang umgehen, weil sie auf den Vollzug von Arbeitspraktiken
einwirken. Sie lassen sich folgendermaßen darstellen:
Abb. 2: Kulturelle Einflüsse ,,Kulturstandards" (Eigene Darstellung)
Auf der Grundlage von Kulturstandards wurde nach den Erfahrungen und
Deutungen über kulturelle Differenzen gefragt. Diese Erfahrungen und Deutungen
bildeten die Grundlage, um das Einfließen dieser Differenzen in die Arbeitspraktiken
27
zu rekonstruieren (in Anlehnung an Reckwitz 2006). Derartige Prozesse verweisen
auf kulturelle Hybridbildungen und es interessierte, inwiefern diese sich
weiterentwickeln zu hybriden Identitätsausformungen.
Um
eine
Operationalisierbarkeit
zu
realisieren,
musste
die
Untersuchungsanlage mit einem empirischen Differenzbegriff operieren, der
kulturelle Differenz als ,,nationalkulturell" geprägte Auslegung aufnimmt. Diese
Essentialisierung wurde aufgefangen durch theoretische Grundlagen und
Kategorien, die interindividuelle und intersubjektive Faktoren erfassen, wie z.B.
Wissensdifferenzen, die aus Unterschieden in der Ausbildung resultieren und
Differenzen in den Arbeitspraktiken. Darüber hinaus wurde Kultur als Gegenstand
kultureller Bildung eingebunden.
2.4. Partizipationstore Kultureller Bildung
Da Kultur und kulturelles Wissen nicht auf kulturelle Differenz zu reduzieren sind,
wurde danach gefragt, welche Art kulturellen Wissens sich die Expatriates aneignen
über Bildung und Qualifizierung. Diese Frage zielt auf Lern- und Bildungsprozesse;
d.h. finden sich in unterschiedlicher Form und mit unterschiedlichen Lernformen
Zugangsportale zur kulturellen Bildung? Diese Frage nimmt eine eigene
Prozessebene des Lernens auf, sie heißt: Bildung und Kulturalität individuelle
Zugänge zum kulturellen Lernen und zu kultureller Bildung. Diese Prozessebene
erfasst nicht kulturelle Differenz in einem essentialistischen Sinne, sondern legt
China als kulturellen Raum, als Inhalt kultureller Bildung aus, der durch drei
empirisch entwickelte Partizipationsportale (vgl. Gieseke u.a. 2005) erschließbar ist:
(a)
verstehend-kommunikativ (z.B. Sprache, Erlernen von Kulturstandards)
(b)
systematisch-rezeptiv (z.B. Auseinandersetzung mit Geschichte)
(c)
selbsttätig-kreativ (Aneignung kultureller Praktiken, z.B. ein Instrument
erlernen).
Werden diese Portale durchschritten, ist eine Aussage darüber möglich, ob und
wie kulturelles Wissen über China erworben wird und ob kulturelle
Aneignungsprozesse stattfinden. Damit wird erfasst, ob selbstorganisiert oder als
28
organisierte Weiterbildung Wissen über China erworben wird. Diese
Aneignungsprozesse sind notwendig, um überhaupt von kultureller und sozialer
Partizipation zu sprechen.
2.5 Lernformen als ,,Motor" der Wissensgenerierung und Kernelement von
Lernkulturen
In der Studie werden zum einen die Anforderungen des Arbeitsplatzes und seiner
Aufgabenfelder und zum anderen die sich daran anschließenden Formen der
Konstitution von Arbeitspraktiken analysiert. Es werden Lernaktivitäten betrachtet
und die Rolle, die sie für den Praktikenaufbau und das Individuum spielen. Leitende
Fragen sind: Werden die Individuen am Arbeitsplatz begleitet? Haben sie
Möglichkeiten, sich in verschiedenen Formen weiterzubilden? Bietet das
Unternehmen eine gestaltete Lernkultur an, auf die man zurückgreifen kann, oder
besteht eine Lernkultur aus den Möglichkeiten, die der Arbeitsplatz selbst im
engeren bietet? Entstehen unter Bedingungen ungestalteter Lernkulturen bzw.
unterstrukturierter Lernkulturen andere Formen individualisierter Bildungskulturen?
Die ausgewählten Lernformen (siehe Abbildung 3) sind Teil eines entwickelten
Lernkulturbegriffs, der davon ausgeht, dass die (gestalteten) Strukturen von
Lernkulturen
Auskunft
darüber
geben,
inwiefern
Qualifizierung
und
Kompetenzentwicklung in einem Unternehmen gepflegt werden (vgl. Gieseke
2009). Lernformen sind ein Kernaspekt der abduktiv konzipierten Prozessebene II:
Professionalisierung und Qualifizierung individuelle Lernformen.
Im Rahmen von Transnationalisierungsprozessen ist die Lernkulturstruktur der
Mutterunternehmen ausschlaggebend, da von dort die politischen Entscheidungen
bezogen auf das Personalmanagement und die Personalentwicklung getroffen
werden, die auch Entscheidungen darüber mit sich führen, ob Lernkulturen
kulturübergreifend, kulturell ,,gemischt" oder kulturspezifisch angelegt sind.
Kulturprogramme und kulturelle Differenzen gehen darin ein.
29
Lernformen sind ein zentrales Strukturmoment von Lernkulturen und sie
wirken auf die Optionen der Wissensgenerierung ein (vgl. auch Robak 2011b,
2012).
Abb.
3: Lernformen als Bestandteil des abduktiven Analysemodells der
Prozessebene II: Professionalisierung und Qualifizierung (Eigene Darstellung)
Betrachtet man die verschiedenen Lernformen, so sind organisierte Formen als
systematisches Lernen zwar diskreditiert worden (Staudt/Kriegesmann 2000), sie
stellen aber einen entscheidenden Teil von Lernmöglichkeiten bereit (vgl. Robak
2012). Es ist auf die besondere Qualität des systematischen Wissens zu verweisen,
die erstaunlicherweise nicht mehr hervorgehoben wird. Das systematische Wissen
basiert auf dem wissenschaftlichen Wissen und verfügt über die höchste
Problemlösekompetenz, es impliziert die höchstmögliche Fragehaltung und ist
Ergebnis operationalisierter Erschließung von Welt (Eirmbter-Stollbrink/Fuchs-
König 2005, S. 10). Der Verzahnung von Arbeiten und Lernen als
arbeitsplatzbezogenes Lernen kommt eine anhaltend hohe Bedeutung zu (vgl.
Dehnbostel 2008), die Transferierbarkeit von Wissen in Handlungskompetenz soll
erhöht werden (Severing 1994). Dies hat eine besondere Beschäftigung mit dem
informellen Lernen, aber auch mit dem impliziten Lernen und sehr breit mit dem
selbstgesteuerten Lernen forciert. Es existiert dazu jeweils eine breite, jedoch
30
empirisch nicht sehr fundiert abgesicherte Literaturlage. In Anlehnung an
Schiersmann (2006) sollen unter selbstgesteuertem Lernen als Lernform im weiteren
konkrete Lernaktivitäten verstanden werden, die der individuellen Erarbeitung und
Generierung von Wissen und Fähigkeiten dienen und eine Organisation des
Lernprozesses aufweisen. Dazu gehören das mediale Lernen und Formen des
arbeitsplatzbezogenen Lernens, die nicht vorrangig kommunikativ informell sind.
Für das selbstgesteuerte Lernen wird davon ausgegangen, dass man sich Wissen zu
einem Lerngegenstand eigenständig erarbeitet. Der Erfahrungsaustausch mit
Kollegen und vielfältige Formen der interaktiven Eruierung von Informationen im
relevanten beruflichen Umfeld werden dem informellen Lernen zugeordnet. Lernen
durch die alltägliche Arbeit gehört zum impliziten Lernen, das in Anlehnung an
Polanyi (1985) Wissen vor allem als selbstreferentielle Form des Erfahrens aufbaut.
Beim impliziten Lernen wird ein Lernprozess erzeugt, dessen Verlauf und Ergebnis
den Lernenden nicht bewusst ist und der nicht reflektiert wird. Lernen ist ein
unbewusster Prozess (ebd.), es ist gänzlich unorganisiert und in das Arbeitshandeln
integriert. Man geht davon aus, dass ein Können als Ergebnis impliziter
Lernbedingungen entsteht, aufgrund von Wahrnehmungen, Handlungen, Erlebnissen
und vorreflexiven Erfahrungen. Dieser Prozess vollzieht sich ohne verbale
Artikulation und Erfahrungsreflexion (vgl. Neuweg 1999). Das resultierende Wissen
ist schwer auszudrücken. Alle Lernformen scheinen Stärken und Begrenzungen zu
haben was die Optionen der Wissensgenerierung betrifft. Es interessiert, auf welche
Lernformen die Expatriates zurückgreifen können, um sich Wissen zu erarbeiten
und Arbeitspraktiken zu strukturieren, um die Arbeitsplatzanforderungen zu
bewältigen und dabei ihre Professionalisierung zu stärken.
3. Exemplarische empirische Ergebnisse
3.1. Arbeitspraktiken, Lern- und Bildungsprozesse des klassischen Expatriates
Die Konstitution von Arbeitspraktiken ist, so zeigen die empirischen Ergebnisse,
einerseits eng an angeeignete Wissensstrukturen gebunden. Andererseits ist in
kulturdifferenten Arbeitszusammenhängen die Konstitution von Wissen auch an
31
Arbeitspraktiken gekoppelt. Dafür braucht es jedoch Lernkulturen. Dies soll an
einem Typus verdeutlicht werden.
Dem Typus des klassischen Expatriates
3
wurden acht Interviewpersonen
zugeordnet, sie wurden zum Teil zweimal im Abstand von 1,5 Jahren interviewt.
Die Auswertung erfolgte entlang des abduktiv entwickelten Modells, das in Kap. 2
auszugsweise dargestellt ist.
Zu den exemplarischen Ergebnissen: Diese akademisch ausgebildete immer
jünger werdende Gruppe arbeitet in globalen deutschen Unternehmen. Für den
Zeitraum von ein bis fünf Jahren bekleiden sie wichtige Schlüsselpositionen und
sollen Abteilungen oder Bereiche aufbauen oder umstrukturieren. Sie interessieren
sich nicht für die Kultur des Landes, eine Entsendung ist auch nicht immer ihr
Wunsch, sie sehen aber Chancen in den äußerst herausfordernden Arbeitsaufgaben,
die sie in China angeboten bekommen. Die Ausschreitung der eigenen Qualifikation
ist eine Hauptmotivation. Die Expatriates hoffen, sich darüber für einen Aufstieg im
Mutterunternehmen zu empfehlen. Dies kann jedoch nicht mehr garantiert werden.
Der Anteil chinesischer Mitarbeiter/innen vor Ort ist sehr hoch. Gerade Joint-
Venture-Unternehmen erfordern eine enge Kooperation mit chinesischen Kollegen.
Besonders auf allen Managementebenen ist die Entscheidungsbefugnis der
deutschen Partner begrenzt und nur unter Zustimmung Aller sind z.B. strategische
und Personalentscheidungen zu treffen. Trotzdem sind die Handlungsspielräume
sehr groß und die Expatriates schöpfen ihre Leistungspotentiale durch ihr im
Studium und im Mutterunternehmen erworbenes Wissen voll aus.
Sie orientieren sich für die vertraglich geregelte Aufgabe der Entsendung an
den Normen und Vorstellungen des Mutterunternehmens. Diese Gruppe hat das
,,kapitalistische Kulturprogramm" verinnerlicht: Die Norm der Selbstaktivierung
muss in China noch verstärkt werden, da sie gleichzeitig vermittelt werden muss.
Arbeitsprozesse sind von Beginn an in höchstem Maße mit Wissensvermittlung
3
Diese Gruppe wird für ein bis fünf Jahre nach China entsendet. Die untersuchten Expatriates arbeiten in deutschen
global operierenden Großunternehmen in leitenden Funktionen, überwiegend in produzierenden Unternehmen
Autobau, Hochtechnologie im Bereich Haushalts- und Industriegeräte, Lichtmanagementsysteme, Mikroskope oder
Hochgeschwindigkeitsweichen. Vertreten ist auch ein Finanzunternehmen.
32
verbunden; d.h. die Expatriates versuchen, die Arbeitspraktiken ihrer
Mitarbeiter/innen dahingehend zu beeinflussen, dass sie Form und Struktur der
mitgebrachten Arbeitspraktiken der Expatriates ,,mitlernen". Grundlage dessen ist
die implizite Vermittlung des Selbstaktivierungsdispositivs, d.h.: Die als ,,passiv"
interpretierte Aktivierungsform auf Seiten der chinesischen Mitarbeiter/innen
möchte man sukzessive umformen. Ein ungeahntes und unvorbereitetes Höchstmaß
an Kommunikation und Wissensvermittlung wird dafür betrieben.
Abb. 4: Lernformen und Praktikenkonstitution für Hybridbildungen des Expat
Classico (Eigene Darstellung)
Wie Abb. 4 zeigt, erweisen sich Arbeitspraktiken für diese Gruppe als die
entscheidende Lerndimension (rechte Seite der Abbildung). Die Konstitution von
Arbeitspraktiken steht im Zentrum der Aktivitäten, dies realisiert sich vor allem über
einen Modus der Durchsetzung und einen Modus der Angleichung. Lernprozesse
finden parallel statt, die Wissensgenerierung realisiert sich vor allem über implizites
Lernen, das unmittelbar passfähiges Wissen über Lern-Handlungs-Einschlüsse
(Learning-action- Inclusions?) in Arbeitspraktiken einlässt. Die Gleichschaltung von
Arbeits- und Lernprozessen ermöglicht nur schwer einen systematischen
Wissensaufbau.
33
Die grundlegende Hybridbildung, die ,,Umformung" der Aktivierungsform
speist sich aus der Vermittlung postbürokratischer Arbeitspraktiken, die an den
Globalisierungsstrategien,
Organisationsstrukturen
und
Werten
des
Mutterunternehmens ausgerichtet wird. Man könnte dies an der Einführung von
Projektarbeit, die in China das Verständnis von Arbeit und den Kulturstandard der
Hierarchie durchkreuzt, plastisch beschreiben.
Es lassen sich vier Praktiken der Expatriates extrahieren, die für die
Konstitution hybrider Praktiken eingesetzt werden. Hybridisierung bedeutet an
dieser Stelle, dass die vorgefundenen Praktiken der chinesischen Mitarbeitenden
nicht einfach ersetzt werden, sondern sie werden gesteuert umgeformt: Die
entscheidende Praktik ist dabei die Wissensinjektion
4
. Die eigenen
Arbeitshandlungen werden in der Weise routinisiert, dass sie gezielt in der
Kommunikation Wissen transportieren. Fachwissen und Prozessstrukturwissen
müssen die Expatriates so erläutern - oftmals in Englisch oder per Übersetzung -,
dass es sowohl systematisch als auch im Handlungszusammenhang des
unmittelbaren
Arbeitsprozesses
angeeignet
werden
kann.
Da
die
Aneignungsprozesse und -ergebnisse des Gegenübers nicht, wie im europäischen
Kontext, abgefragt werden können, muss die Wissensinjektion oft und in
kontinuierlichen Abständen wiederholt werden. Die Absicherung des eigenen
Wissensüberschusses ist dafür eine zentrale Voraussetzung. Nur der Erhalt
abstrakter fachlicher Wissensstrukturen sichert Beruflichkeit in mittel- bis
langfristiger Perspektive. Mit dem Ausgleich der Wissensstrukturen nach ein paar
Jahren kann ein persönlicher Kompetenzverlust einsetzen, der aus mangelnden
Möglichkeiten des Wissenserwerbs und aus Leistungsabschöpfung resultiert.
Die zweite Praktik ist der parallelisierende Strukturaufbau durch
Entscheidungen, d.h. die Expatriates orientieren sich für Strukturentscheidungen am
Mutterunternehmen und stimmen diese daraufhin ab. Die dritte Praktik, dominante
4
Der Begriff der Wissensinjektion ist empirisch gewonnen und bringt zum Ausdruck, dass die Tätigkeit der
Expatriates so erweitert ist, dass diese für alle entscheidenden Prozesse sowohl intentional als auch implizit über
unterschiedliche Formen der Kommunikation Wissen in Arbeitsprozesse einfließen lassen und damit permanent an
der Veränderung und Konstitution von Arbeitspraktiken entscheidend mitwirken.
34
Kommunikationskonstellationen schaffen, sichert den Machterhalt innerhalb von
Joint-Venture-Unternehmen; d.h. für Arbeitszusammenhänge, insbesondere für
Entscheidungen, Prozessentwicklungen und interne Gremien werden die
Kommunikationspartner gezielt ausgesucht, Positionen genauestens abgestimmt, um
entsprechende Dominanzen für Interessensdurchsetzung herzustellen. Diese Praktik
setzen die deutschen Expatriates besonders dann ein, wenn die eigenen
Entscheidungsbefugnisse eingeschränkt sind oder man chinesische Hierarchien
umgehen möchte. Die Etablierung von Unternehmenskulturen und die Installation
von Werten bilden eine eigene Praktik (vier) aus. Diese vier Praktiken realisieren
Hybridbildungen vor Ort über faktisch geschaffene Strukturen und Arbeitspraktiken.
Organisiertes Lernen als Form der Wissenszufuhr
5
ist überwiegend nicht
ausreichend gesichert. Aus diesem Grund haben die Expatriates große Mühe Wissen
zu generieren, geschweige denn separate Praktiken der Wissensgenerierung zu
entwickeln. Von Ausnahmen abgesehen, gestalten die Unternehmen keine
länderübergreifenden Lernkulturen. Oftmals sind die internen Netzwerke,
insbesondere zum Mutterunternehmen, die einzigen Wissensressourcen. Informelles
Lernen erhält deshalb einen hohen Stellenwert, weil keine systematischen Angebote
vor Ort vorhanden sind.
Gleichzeitig entwickelt sich durch Forschung und Entwicklung, besonders im
Hochtechnologiebereich, in den Unternehmen ein Know How, das als
unternehmensspezifisches Wissen einen eigenen hohen Stellenwert hat. Dieses
gelangt dann nur über die Expatriates und funktionierende Netzwerke nach China.
Institutionalisierte Strukturen der Wissenszufuhr sind nicht ausreichend geschaffen.
Vier Wissensbereiche haben sich als besonders relevant herauskristallisiert:
unternehmensspezifisches Know How (entwickelte Verfahren, Prozesse,
Produktstrukturen und Produktwissen), technisches und technologisches
Grundlagenwissen, fachliches Grundlagenwissen, Schlüsselqualifikationen und
5
Der Begriff der Wissenszufuhr ist ebenfalls empirisch gewonnen und bringt zum Ausdruck, dass Wissensressourcen
durch unterschiedliche Lernangebote und Lernmöglichkeiten abgesichert bzw. nicht abgesichert werden, die nicht
dem unmittelbaren Arbeitsprozess dienen und für die individuelle Entwicklung von Beruflichkeit genutzt werden
können.
35
kulturelles Wissen im umfassenden Sinne. Keine dieser Wissensressourcen ist
ausreichend über Lernkulturen gesichert.
Lernen im Prozess erweist sich als ein Vorgang, bei dem vor allem implizit
über Erfahrungen ,,getestet" wird, ob das eigene Wissen greift, ob das vermittelte
Wissen individuell und strukturell ankommt und gewünschte Prozesse freisetzt.
Ein Wissensrückfluss, gewissermaßen aus der Antizipation, Analyse und dem
Verstehen der fremdkulturellen Praktiken heraus, findet nur bei einigen
fragmentarisch statt, wenn ein kulturelles Lerninteresse aufgebaut wird. Die in
Kapitel 2.2 genannten Kulturstandards eignet sich diese Gruppe nicht wirklich an.
Sie werden entweder nur partiell verstanden oder strategisch zum Erreichen der
eigenen Ziele eingesetzt, wenn man Kulturstandards rudimentär zur Kenntnis
genommen hat. Es wird aber jeweils nur eine strategische Auslegung gelernt und es
werden überwiegend strategische Erfahrungen im Umgang damit gemacht. Dies gilt
besonders für den Kulturstandard ,,Beziehungen herstellen".
Formen kultureller Bildung finden sich bis auf wenige Grundlagensprachkurse,
die von einigen besucht werden, nicht. Keines der drei Partizipationsportale wird
wirklich durchschritten. Dadurch erhalten die Expatriates keinen Zugang zur
chinesischen Realität, sie haben nur äußerst begrenzt an chinesischen Lebenswelten
teil. Die Bindung ans Unternehmen ist dann noch größer. Die Expatriates bemerken
in den Prozessen der permanenten Wissensinjektion nicht ihren eigenen
Qualifikationsverlust, der erst nach Rückkehr als Wissensverlust spürbar wird.
Mangelnde kulturelle Bildung und die beschleunigten kapitalistischen
Entwicklungen in China verhindern die Erweiterung von Deutungen und
Interpretationsmöglichkeiten. Die Arbeitsstrukturen und die modellierten
routinisierten Praktiken verselbständigen sich. Über die Konstitution und
Modellierung von Praktiken haben die Expatriates die Interessen der Unternehmen
gesichert, ein impliziter Effekt der Machtsicherung. Ihre eigenen Praktiken jedoch
haben sich ebenfalls ,,deformiert", was sich nach ihrer Rückkehr nach Deutschland
als schwierig erweist. Aus diesem Grunde sollte ein Aufenthalt aus Sicht der
Unternehmen wohl fünf Jahre nicht überschreiten. Die Unternehmen ihrerseits
36
bemühen
sich,
um
unliebsame
Anpassungen
zu
vermeiden,
über
Unternehmenskulturen um eine gesteuerte Annäherung an fremdkulturelle
Standards. Die von den Expatriates interpretierten Differenzen betreffen jedoch
besonders die Wissensgrundlagen und die Arbeitspraktiken. Da diese Differenzen
auf mangelnde Standards in der chinesischen Hochschulausbildung zurückgeführt
werden, besonders in den Bereichen Marketing, Qualitätssicherung und
übergreifende Fachstrukturen, bleibt der Fokus auf Wissensvermittlung und
gesteuerte Hybridbildung erhalten. Dies korelliert mit einem geringen Interesse die
chinesische Sprache zu lernen. Die systematischen Zusammenhänge der historischen
Entwicklung und die jüngere Geschichte Chinas bleiben im Dunkeln. Eine
beobachtend-begleitende oder gar kritisch-analytische Sicht auf gesellschaftliche
Entwicklungen bleibt aus. Durch die kulturelle Leerstelle kann Wissen so nicht über
Praktiken, die ,,aus chinesischen kulturellen Quellen" stammen, an die Expatriates
zurückfließen. Die Sicherung von Macht über Wissensstrukturen hat die Kehrseite,
dass Wissensstrukturen aus dem ,,fremdkulturellen System" nicht antizipiert werden
können. Es finden sich auch viele Belege dafür, dass Wissen vorenthalten wird, dies
gilt für alle beteiligten Akteure der verschiedenen Kulturen.
3.2. Arbeitspraktiken, Lern- und Bildungsprozesse der Kosmopolitischen
Nomaden
Die Kosmopolitischen Nomaden suchen die Fremde und wollen in China ,,dabei
sein". Sie haben ihren Weg nach China von langer Hand vorbereitet. Dabei steht
nicht nur die Karriereorientierung im Vordergrund. Die Kultur und die
gesellschaftspolitischen Entwicklungen sind von besonderem Interesse. Man möchte
die wirtschaftlichen Entwicklungen mitgestalten und dabei lernen, wie
Geschäftsbeziehungen in China funktionieren. Diese Gruppe geht nach China mit
zeitlich offenem Horizont und bleibt über längere Zeiträume, bisweilen bis zu 15
Jahre, dort. China ist für sie eine Station unter anderen. Sie haben bereits in anderen
Ländern gelebt, wechseln zwischen Ländern und auch Orten in China, die sie
interessant finden. Dabei folgen sie nicht vordergründig der Arbeit, sondern ihrem
37
Interesse an der jeweiligen Kultur und an der Lernhaltigkeit und dem
Handlungsspielraum der Arbeitsstelle. Insgesamt wurden vier Personen diesem
Typus zugeordnet. Alle sind im mittleren Erwachsenenalter, nicht älter als Mitte 40,
sie sind hochqualifiziert, einige sind doppelt qualifiziert, haben wirtschaftsbezogene
Fächer, z.T. in Kombination mit Regionalwissenschaften, studiert. Internationalität
wird bewusst in der Bildungsbiographie angelegt, z.B. indem international an
verschiedenen Standorten studiert wurde. Die chinesische Sprache wurde
vorbereitend gelernt, entweder im sinologischen Studium oder vor Beginn einer
Tätigkeitsaufnahme. Sehr gut ausgebildet beginnen sie ihre Karriere in großen
multinationalen Unternehmen und arbeiten sich sukzessive nach oben in leitende
Positionen, bis hin zum Top-Management. Studium, Auslandsaufenthalte,
Berufseinstieg sind miteinander verwoben und erfolgten zum Teil bereits in China
oder in anderen Ländern. Entsendungen nach China erfolgen auf eigenen Wunsch,
die eingenommenen Positionen vor Ort sind leitend und besonders
verantwortungsvoll, d.h. sie leiten z.B. große strategisch wichtige Abteilungen,
haben übergreifende Regionalverantwortung oder leiten Firmen(bereiche). Sie
schätzen besonders die Gestaltungs- und Handlungsspielräume und wollen sich als
Allrounder, aber gleichzeitig auch spezialisiert, individuell weiter entwickeln.
In China lässt sich diese Gruppe sehr eng auf die kulturellen Bedingungen vor
Ort ein, sucht geradezu verschiedene Erfahrungsräume für sich zu öffnen, um die
eigenen Fähigkeiten auf hohem Niveau auszuschreiten. Dabei begreifen die
kosmopolitischen Nomaden das fremdkulturelle Umfeld als Inspiration, nähern sich
den chinesischen Bedingungen beruflich und privat an. Diese Gruppe gilt als
erfolgreiche ,,Globalisierer" mit Expertenstatus. Trotz aller Verbundenheit mit den
anstellenden Unternehmen behalten sie immer eine relationale Unabhängigkeit, die
sie durch individuelle Kompetenzentwicklung und Expertise, welche sowohl
fachlich als auch kulturell gespeist ist, sichern.
Kultur wird für sie Inhalt und Struktur, die Arbeitsfelder verlangen die
Integration kulturellen Wissens und das Beherrschen chinesischer Umgangsformen.
Im Arbeitszusammenhang praktizieren sie eine mimetische Hybridbildung, d.h. sie
38
integrieren gezielt kulturelle Elemente und generieren neue Praktiken. Sie tun dies
von allen Typen am intensivsten und gezielt. Man überlässt sich keiner
fremdkulturellen Überdetermination und will auch nicht einseitig Praktiken und
Strategien des Mutterunternehmens durchsetzen, sondern generiert gezielt hybride
Praktiken, indem fremdkulturelle Elemente angeeignet und kreativ in neue Praktiken
über Modi des Angleichungshandelns eingelassen werden.
Diese Gruppe realisiert die breitesten Formen an Hybridbildungen,
selbstbezogene wie auch vermittelte. Hybridbildungen sind in vierfacher Weise
nachweisbar und reichen von der Annahme bereits hybrider Formen der
Selbstaktivierung, die aus dem ,,kapitalistischen Kulturprogramm" stammen, bis hin
zur mimetischen Integration kultureller Aspekte durch Sprache und kulturelle
Wissensaneignung. Kulturstandards werden interpretiert, differenziert und mit
Deutungsmustern verbunden, neue Deutungsmuster formen sich aus, über die man
in der Interaktion verfügt. Das Besondere dieser Gruppe ist, dass sie auch
postbürokratische Arbeitspraktiken transportiert und Selbstaktivierung umsetzt, dies
aber unter Berücksichtigung kultureller Aspekte realisiert. Die Kosmopolitischen
Nomaden greifen dafür auf alle vorhandenen Wissensstrukturen zu, um das
notwendige Wissen zu verkoppeln und in Arbeitsprozesse einzugeben. Sie brauchen
sich und die eigenen Ressourcen und Wissenspotenziale jedoch nicht auf, indem sie
all ihr Wissen abgeben, sondern sie sorgen für Wissensgenerierung und
Wissensbeschaffung (siehe Abb. 5). Die Verbindung aller Wissenspotenziale und
die Integration kulturellen Wissens führen dazu, dass eine weitere
Kompetenzentwicklung und Professionalisierung einsetzt. Die Fähigkeit mimetische
Hybridbildungen zu realisieren lässt Wissensrückflüsse entstehen und die flexible
Partizipation an weltweiten Qualifizierungsangeboten sowie die Fähigkeiten des
Selbstlernens und Austausches sichert langfristig notwendige Wissensgrundlagen.
39
Abb.
5: Lernformen und Praktikenkonstitution für Hybridbildungen der
Kosmopolitischen Nomaden (Eigene Darstellung)
Die Kosmopolitischen Nomaden gestalten ihre Lernprozesse autonom und
unabhängig. Sie bringen ebenfalls ihr Wissen in Arbeitsstrukturen ein, jedoch
schichten sie gleichzeitig ihr Wissen auf. Alle Lernformen sowie verschiedene
Wissensressourcen und Wissensformen werden aktiviert und genutzt. Es fließen
fachliches Wissen, unternehmensspezifisches Wissen und kulturelles Wissen ein.
Sie sind die einzige Gruppe, die den Praktikenaufbau in dieser gekoppelten Form
realisieren kann. Kulturelles Wissen ermöglicht kulturformende Hybridbildungen
über mimetische Hybridbildungsprozesse.
Die Arbeitsprozesse zeichnen sich durch eine besondere Kombination von
Wissensverknüpfungen aus. Kulturelle Differenz wird mittels Hybridbildungen
gezielt eingebunden. Dafür wird der Angleichungsmodus als Kulturkonstitution mit
dem Durchsetzungsmodus in besonderer Weise verbunden. Es realisieren sich
eigene kulturelle Räume, die Neues entstehen lassen.
Diese Gruppe verfügt über Lernkulturen, auf die sie zugreifen kann, sie hat
aber vor allem auch ein individuelles Repertoire an Lernformen, das flexibel
aktiviert wird. Dabei achten alle auf die Balance der Lernformen, um sowohl
benötigtes Wissen zu generieren als auch einen transferierbaren Wissensüberschuss
zu sichern.
40
Wer in einem Karriereförderprogramm ist, hat in Abständen Assessments zu
durchlaufen und bestimmte Qualifizierungen nachzuweisen. Arbeits- und
Lernprozesse dieser Gruppe sind getrennt ausgewiesen und sichern eine
transferierbare Kompetenzentwicklung (siehe Abb. 6).
Die eigene Kompetenzentwicklung erfolgt sukzessive, diese reicht von
Seminaren in Europa und in den USA, über Angebote in Institutionen vor Ort und
Einzelcoachings bis hin zur eigenständigen Wissenserarbeitung durch Fachliteratur.
Zeitressourcen werden dafür eingeräumt.
Abb. 6: Lernprozesse der kosmopolitischen Nomaden zwischen individualisierten
Bildungsräumen und Lernkulturen (eigene Darstellung)
Insgesamt muss eher von kulturübergreifenden individualisierten Bildungsräumen
für diese Gruppe gesprochen werden, die zwar durchaus auf Lernkulturen im
Unternehmen und institutionalisierte Unterstützung vor Ort in China zurückgreift,
jedoch in gleicher Weise individualisierte Formen des Lernens nutzt und dafür
globale Optionen der Bildungspartizipation punktuell und gleichzeitig systematisch
in Anspruch nimmt (Abb. 6).
41
Die Kosmopolitischen Nomaden kennen die Kulturstandards, haben zum Teil
langjährige Erfahrungen damit und können dieses Wissen in ihr Handeln integrieren,
zum Teil ist es einsozialisiert, d.h. bereits zur ,,zweiten Haut" geworden.
Gleichzeitig entwickeln sie eine kritische Distanz dazu. Kritische Einschätzungen
scheinen aus dem kulturellen Wandel in China zu resultieren. Der kulturelle Wandel
im Land bringt Ungleichmäßigkeiten und Deformationen in der interaktiven
Nutzung der Kulturstandards hervor. Zu den Erfahrungen im Umgang mit
Kulturstandards sind eigene Deutungen konstruiert worden, der Umgang mit ihnen
ist nicht vordergründig instrumentell, sondern wird in differenzierter Weise gepflegt.
Kulturelles Wissen reicht weit über die Kulturstandards hinaus. Besondere
Bedeutung erhält aber auch hier der Kulturstandard der Beziehungspflege, welcher
in besonders ausdifferenzierter Weise kultiviert wird.
Kulturelle Bildung findet vor Ort in China auch bei dieser Gruppe nicht statt.
Jedoch finden sich Formen kulturellen Lernens bzw. kulturelles Wissen bei dieser
Gruppe am breitesten bis hin zu einer wissenschaftlichen sinologischen Ausbildung.
Kulturelles Wissen ist ein Kernbereich des professionellen Wissens, es bildet eine
Grundlage zur Ausübung der Tätigkeit. Die Geschäftsprozesse und die
Markterschließung stehen im Mittelpunkt. Die kosmopolitischen Nomaden besitzen
nicht nur allgemeines und systematisches Wissen über China, sondern auch Wissen
über Wirtschaft, Wirtschaftsstrukturen, fachliche Differenzen und gesellschaftliche
Entwicklungen. Es ist auch wichtig, politische Entscheidungsprozesse verstehen zu
können, um mögliche Folgen für Unternehmen abzuwägen. Der verstehend-
kommunikative Zugang der Wissenserschließung spielt eine entscheidende Rolle für
die kulturelle Aneignung. Sprache ist das wichtigste Tor zum Kulturverstehen, zur
Professionalisierung im Arbeitszusammenhang und zur Ausübung einer
mimetischen Hybridbildung. Vor Ort ist eine systematisch-rezeptive Beschäftigung
insgesamt rudimentär. Findet sie statt, ist sie selbstgesteuert, nicht in Formen
organisierter Bildung und dient wirtschaftlichen Aufgabenfeldern. Ein selbsttätig-
kreativer Zugang zur Erschließung von Kultur wird nur von einer Person praktiziert.
42
Die Kosmopolitischen Nomaden erfahren China als einen Lern- und
Bildungsraum, den sie durch Erfahrungen und Wissensgenerierung erschließen.
Lern- und Bildungsprozesse folgen einerseits einer Verwertungsorientierung, indem
das generierte kulturelle Wissen in Wirtschaftsprozesse eingelassen wird, und sie
bieten andererseits Möglichkeiten der individuellen Entfaltung, die besonders aus
den anspruchsvollen und verantwortungsvollen Leitungsaufgaben resultieren und
aus den Erfahrungen der mimetischen Kulturkonstitution. Sie ziehen also einen
besonderen Gewinn daraus, dass sie einen intersubjektiven Umgang mit
chinesischen Mitarbeitern und Kollegen und über diese hinaus entwickeln und sich
breitere Ausschnitte der chinesischen Realität erschließen als jede andere Gruppe.
Eine Rückkehr nach Deutschland bzw. Europa kann aufgrund der Erfahrungen
großer Handlungsspielräume und Entscheidungskompetenzen schwierig werden,
dieses wird auch nur von einer Person, die eine Familie hat, anvisiert. Dabei
entwickeln die Betreffenden eine sinisierte Tönung des subjektiven Kerns.
Gedeutete Differenzen lösen sich auf und sind als hybride Struktur ins Handeln und
in die Praktiken eingeflossen. Dies macht eine hybride Kulturalität aus, d.h. die
kosmopolitischen Nomaden können sich partiell als zugehörig empfinden und
verarbeiten diese Erfahrung als individuelle Stärke.
Angesichts der Breite und Intensität ihrer Erfahrungsfelder erarbeiten sie sich
das breiteste Deutungswissen. Die intensive sowohl fachliche als auch kulturelle
Beschäftigung eröffnet ein breites Spektrum an Deutungszugängen bis hin zum
transkulturellen Perspektivwechsel als die Fähigkeit, die Deutungssysteme
wechselweise zu verstehen und zwischen ihnen zu wechseln. Anerkennung
entwickelt sich im Prozess durch die Bereitschaft zur mimetischen Hybridbildung,
in die sich der kulturell Andere mit seinem Wissen und seinen Arbeitspraktiken
einbringen kann. Das gemeinsame Handeln und die gemeinsame Konstitution von
Wissen mit der Haltung und Bereitschaft, involvierte Beziehungen zu pflegen,
lassen wechselseitig Vertrauen entstehen. Erst das Überschreiten der
Kulturstandards, welche an strategischen Positionen festhalten, ermöglicht einen
43
Vertrauensbildungsprozess, da sich Intersubjektivität in der kontinuierlichen
Interaktion aufbaut und Wirklichkeit in Form von Alltagswissen formt.
Transnationalität, Expertise, große Verantwortungsbereiche und das breite
Erfahrungsspektrum aufgrund kultureller Annäherung, an der die verschiedenen
Akteure partizipieren, setzen Kreativität frei, geben Selbstvertrauen und können in
eine reflexive Kulturalität münden die Fähigkeit sich distanziert einzubetten,
kulturell zu verorten und eine individuelle Bereicherung zu erfahren und zu
bilanzieren.
Kosmopolitismus ist also nicht vorgeprägt, sondern auf der Grundlage von
berufs- und bildungsbiographischer Gestaltung, Wissen und Erfahrungen erarbeitet.
4. Fazit: Zur Notwendigkeit transnationaler Lernkulturen
Die Gruppe der Expat Classico und der Kosmopolitischen Nomaden bauen
unterschiedliche Aspirationen und Motivationen für eine Entsendung auf, haben
unterschiedliche Arbeitsplatzanforderungen und nutzen unterschiedliche Optionen
der Lernkulturgestaltung.
Am Beispiel der Expat Classico wird folgendes sichtbar: Weiterbildung in
deutschen global operierenden Unternehmen in der VR China, so ein Fazit, ist
unterentwickelt. Die Informalisierung von Wissenserwerb und Lernen birgt zum
einen biographische Gefahren des Kompetenzverlustes, zum anderen wird kreative
Innovationsförderung nicht unterstützt. Hinzu kommt, dass die kulturellen Chancen
ungenutzt bleiben: Sozialität und Deutungsverschränkungen als Gestaltung
gesellschaftlicher Verflechtungen können so nicht realisiert werden, sie sind gar
nicht im Blick.
Hybridisierungen, die verschiedene Wissensressourcen aufnehmen, bergen
unbekannte Potentiale für die Wissensgenerierung. Dies erfordert, dass
transnationale länderübergreifende Lernkulturen gestaltet werden, die sowohl die
langfristige Beruflichkeit im Blick haben als auch die unmittelbaren
Arbeitsplatzanforderungen und darüber hinaus die verschiedenen Zugänge des
kulturellen Lernens. Eine Fokussierung auf punktuelle interkulturelle Trainings reicht
44
nicht aus wie auch das Aussetzen jeglicher Personalentwicklung nicht durch
informelles Lernen selbst aufgefangen werden kann. Transnationale Lernkulturen
behalten die Individuen in ihren qualífikatorischen Voraussetzungen, kulturellen
Gebundenheiten und möglichen berufsbiographischen Optionen im Blick und
offerieren ein Angebotsspektrum, das sowohl organisierte Formen der Weiterbildung
als auch arbeitsplatzbezogene umfasst. Wichtig ist es dabei, Arbeits- und
Lernprozesse voneinander zu entkoppeln, dafür braucht es Zeitressourcen. Kulturelle
Bildung und kulturelles Lernen sind in einem breiteren Verständnis als Teil der
Lernkultur zu fassen und können nicht auf kulturelle Differenz reduziert werden.
Transnationalisierungsentscheidungen in Unternehmen denken in einem solchen
Entwurf eine breite Struktur einer entsprechenden Lernkultur mit. Einzelne
transnationale Unternehmen entwickeln derartige übergreifende Strukturen, sie waren
jedoch nicht in den untersuchten Unternehmen anzutreffen. Es würde dann auch
erfordern, dass vor Ort in China Kooperationen und Netzwerke zu anderen
Weiterbildungsinstitutionen entwickelt werden, die für die verschiedenen
Wissensbedarfe auch Bildungsimporte anbieten.
Die Kosmopolitischen Nomaden bilden die am besten ausgebildete Gruppe mit
höchster transnationaler Aspiration, die sich (berufs)biographisch sehr autonom,
entscheidungsfreudig und aufstiegsorientiert weiter entwickeln, ihre Arbeitsstrukturen
mit einem vergleichsweise hohen Handlungsspielraum gestalten können und
umfangreich in institutionalisierter Form an Qualifizierungsangeboten partizipieren,
dies in einem globalen Aktionsradius, als auch in individualisierter Form eigene
Bildungsräume gestalten und individuelle Bildungskulturen entwickeln. Die hier
analysierten Partizipationsmöglichkeiten stellen für das Gros der Auslandsentsendeten
nicht den Normalfall dar. Diese Gruppe wird sich vielmehr daran beteiligen müssen,
ihrerseits Lernkulturen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entwickeln, die
eine transnationale Struktur haben, d.h. sowohl kulturübergreifend als auch
kulturspezifische Fragestellungen aufnehmend, angelegt sind.
Transnationale Lernkulturen werden sowohl für die Erfüllung der unmittelbaren
Tätigkeiten vor Ort als auch für individuelle langfristige Entwicklung der
Details
- Pages
- Type of Edition
- Erstausgabe
- Publication Year
- 2017
- ISBN (Softcover)
- 9783960671206
- ISBN (PDF)
- 9783960676201
- File size
- 10.9 MB
- Language
- English
- Publication date
- 2017 (March)
- Keywords
- Interkulturelle Kommunikation Interkulturelle Kompetenz Transmigration Internationales Management Intercultural communication Cross-cultural communication International management Interculturality
- Product Safety
- Anchor Academic Publishing